Corona in Baden-Württemberg: Affenberg startet mit verhaltenem Optimismus
Baden-Württemberg - In Baden-Württemberg ist die Zahl der Covid-Infizierten zuletzt deutlich in die Höhe geschossen.

Teils werden mehr als 30.000 neue Infektionen pro Tag durch das Landesgesundheitsamt gemeldet.
Derweil gilt seit dem 28. Januar eine neue Corona-Verordnung im Südwesten der Republik.
Clubs, Diskotheken und Messehallen bleiben zu. Jedoch kippte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die 2G-Regel für den Einzelhandel.
Somit können auch wieder nicht gegen Covid-19 getestete Personen in die Läden. Seit dem 24. Januar dürfen auch Studenten mit negativem Test wieder Präsenzveranstaltungen der Hochschulen besuchen.
Mittlerweile gibt es 2.399.978 bestätigte Infektionen in Baden-Württemberg. 14.584 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (Stand: 10. März)
Die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus Sars-CoV-2 in Baden-Württemberg gibt es hier im Ticker. Ältere News könnt Ihr hier nachlesen.
Update, 11. März, 6.35 Uhr: Affenberg startet mit verhaltenem Optimismus
Besucher des Affenbergs in Salem (Bodenseekreis) müssen dieses Jahr auf Popcorn zum Füttern der Tiere verzichten - und für den Eintritt tiefer in die Tasche greifen. "Wir haben die Preise erhöht, was auch mit den Kosten wegen der Corona-Auflagen zu tun hat", sagte Parkleiter Roland Hilgartner vor dem Start der Saison am Samstag. "Das hatten wir in den beiden vergangenen Jahren noch vermieden." Die Preise steigen deshalb für Erwachsene von neun auf zwölf Euro, für Kinder ab fünf Jahren von sechs auf acht Euro.
Besucher des Freigeheges mit rund 200 Berberaffen müssen wie in der Vorsaison zudem auf das Füttern der Tiere mit Popcorn verzichten. "Zum einen, weil Corona nicht aus der Welt ist", sagte Hilgartner. "Zum anderen haben wir damit total positive Erfahrungen gemacht."
Das Popcorn war zunächst abgeschafft worden, um ein mögliches Risiko einer Corona-Infektion für die Affen auszuschließen. Viele Gäste hätten ohne die Fütterung aber mehr Zeit mit dem Beobachten und Entdecken der Tiere verbracht - und in der Folge mehr interessierte Fragen an die Mitarbeiter gerichtet, betonte Hilgartner. "Die positiven Aspekte überwiegen bei weitem."
Zumindest verhalten optimistisch blickt Parkleiter Hilgartner auch auf die kommende Saison. Man starte am Samstag mit 3G-Regeln für die Besucher und hoffe auf eine "etwas nachhaltigere" Öffnung im Sommer. "Es wäre schön, wenn wir nicht wie im vergangenen Jahr alle zwei Wochen mit neuen Regeln konfrontiert werden", sagte Hilgartner.
Hatten vor Corona jährlich noch mehr als 400.000 Menschen pro Jahr den Affenberg besucht, waren es in den Jahren 2020 und 2021 jeweils weniger als 300.000."Das hat sich auch in den Umsätzen bemerkbar gemacht", sagte Hilgartner. Nun freue man sich aber auf die Öffnung.

Update, 10. März, 18.35 Uhr: Weitere 22 Menschen sterben in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit Covid-19
Das baden-württembergische Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, dass die Corona-Inzidenz von 1646,5 auf 1700,7 gestiegen ist. Außerdem starben weitere 22 Menschen, sodass sich die Anzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen auf 14.584 erhöhte. Seit Pandemie-Beginn haben sich im Südwesten 2.399.978 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.
Update, 9. März, 18.20 Uhr: Inzidenz steigt weiter
Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche kletterte innerhalb eines Tages von 1551,8 auf 1646,5 (Stand: 16 Uhr), wie das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart mitteilte. Binnen einer Woche stieg der Wert demnach um etwas mehr als 300.
Dennoch geht das LGA seinem aktuellen Lagebericht zufolge davon aus, dass der Höhepunkt der fünften Welle im Südwesten "vermutlich überschritten" wurde. Seit Ende Februar bleibe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen "relativ stabil auf sehr hohem Niveau, mit leichtem Anstieg in den letzten Tagen".
Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 41.001 neue Infektionen im Land - ein Anstieg auf 2.362.002 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind in Baden-Württemberg mittlerweile 14.562 Menschen gestorben. Das sind 34 Todesfälle mehr als am Vortag.
Auf den Intensivstationen im Land lagen am Mittwoch demnach 251 Covid-Patientinnen und -Patienten, 11,4 Prozent der Intensivbetten waren mit Covid-Erkrankten belegt. Bei beiden Werten waren die Unterschiede zu Vortag und Vorwoche gering. Das galt auch für die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die binnen einer Woche und pro 100 000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, lag am Mittwoch bei 7,3.
Update, 9. März, 8.18 Uhr: Weniger Patente angemeldet - Zweiter deutlicher Rückgang
In Deutschland werden weniger Patente angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zählte im vergangenen Jahr 58 568 Anmeldungen, wie es am Mittwoch mitteilte. Das sind 5,7 Prozent weniger als 2020. Bereits im ersten Corona-Jahr hatte das Amt einen deutlichen Rückgang festgestellt. In den Jahren 2017 bis 2019 hatten die Anmeldungen jeweils über 67 000 gelegen.
"In der Bilanz schlagen sich noch immer die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nieder", sagte DPMA-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer. "Viele Unternehmen wählen restriktiver aus, welche Entwicklungen sie anmelden."
Unter den deutschen Bundesländern hat Baden-Württemberg die Nase vorne - sowohl mit der Gesamtzahl von 13 570 Anmeldungen als auch mit 122 Erfindungen pro Kopf. Das in beiden Kategorien zweitplatzierte Bayern kommt auf 11 875 Anmeldungen beziehungsweise 90 pro Kopf. Die folgenden Bundesländer sind weit abgeschlagen: Nordrhein-Westfalen kommt auf 5675 Anmeldungen, Niedersachsen auf 2982 und Hessen auf 1479.
Update, 9. März, 6 Uhr: Corona-Inzidenz im Südwesten wieder über 1500
Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg bei Corona-Neuinfektionen ist wieder über die 1500er-Marke gestiegen. Innerhalb einer Woche wurden bei 1551,8 je 100.000 Einwohnern Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen, wie das Landesgesundheitsamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Das waren 67,2 mehr als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert sogar um fast 200 niedriger gelegen: bei 1355,1.
Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 36.326 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2.321.001 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14.528 Menschen gestorben. Das waren 46 mehr als am Vortag.
Seit Jahresbeginn wurden den Behörden 1017 Covid-19-Ausbrüche aus Schulen mit insgesamt 5231 Sars-CoV-2-Infektionen sowie 554 Ausbrüche aus Kitas mit zusammen 3912 Infektionen übermittelt, wie aus den Daten hervorgeht. Der Anteil der unter 20-Jährigen an den Infektionsfällen der vergangenen sieben Tage betrage 23 Prozent, jener der über 60-Jährigen hingegen nur 12 Prozent.
Auf den Intensivstationen im Land lagen den Angaben nach am Dienstag 246 Covid-Patientinnen und -Patienten. Das waren sieben weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor waren es 271 Menschen. Im Moment seien 11,1 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten belegt - hier gibt es demnach nur leichte Rückgänge im Tages- und Wochenvergleich.
Die Zahl der Corona-Infizierten in Baden-Württemberg, die innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in ein Krankenhaus kamen, stieg um 0,4 auf 7,1. Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz im Land knapp darunter bei 7,0 gelegen.
8.194.970 Menschen in Baden-Württemberg sind inzwischen mindestens einmal geimpft. Das seien 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, teilte das Amt weiter mit. Als geboostert - durch eine Auffrischungsspritze - gelten 6.232.111 Menschen beziehungsweise 56,1 Prozent.

Update, 8. März, 6 Uhr: Erneut mehrere Demos gegen die Corona-Politik
In einigen Städten in Baden-Württemberg haben am Montag erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Politik protestiert. In Pforzheim und umliegenden Gemeinden seien insgesamt etwa 2000 Menschen auf die Straße gegangen, sagte ein Sprecher der Polizei.
Unter den zwölf Demonstrationen seien aber auch Versammlungen von Befürwortern der Corona-Politik gewesen. Die Demos seien bis zum frühen Abend störungsfrei verlaufen.
Auch in Stuttgart, Freiburg und Reutlingen fanden nach Angaben der Polizei mehrere Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Teilnehmerzahlen konnten die Beamten am Abend zunächst nicht nennen. Zwischenfälle wurden ebenfalls nicht gemeldet.

Update, 7. März, 20.21 Uhr: Über 20.000 neue Infektionen
Für Montag meldet das Landesgesundheitsamt 20.067 neue Corona-Infektionen. Damit haben sich inzwischen 2.284.675 Menschen angesteckt.
Es wurden 44 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger bekannt, die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 14.482.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 1484,6. Derzeit werden 253 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, elf mehr als am Sonntag.
Update, 6. März, 16.32 Uhr: Knapp 15.000 neue Infektionen
Für Sonntag meldet das Landesgesundheitsamt 14.970 neue Corona-Infektionen. Damit haben sich inzwischen 2.264.608 Menschen angesteckt.
Es wurden 15 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger bekannt, die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 14.438.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 1485,7. Derzeit werden 242 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, drei weniger als am Samstag.

Update, 6. März, 10.24 Uhr: Erneut demonstrieren Tausende gegen Corona-Maßnahmen
In mehreren baden-württembergischen Städten haben am Samstag erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht protestiert. In Reutlingen zogen nach Schätzungen der Polizei etwa 3500 Personen durch die Innenstadt, deutlich weniger als erwartet. Angemeldet waren nach Angaben der Stadtverwaltung rund 7000 Teilnehmer. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Wir sind die Menschheitsfamilie". Die Polizei war mit einen Großaufgebot im Einsatz.
Mit Trommeln und mit Trillerpfeifen brachten die Demonstrationsteilnehmer ihren Unmut über die Corona-Politik lautstark zum Ausdruck. Auf Plakaten wandten sie sich gegen die Impfpflicht. "Gesund ohne Zwang" war auf einem der Protestschilder zu lesen, auf einem anderen Banner stand "Freiheitsräuber vor Gericht! Widerstand ist Pflicht!!!". In Reutlingen gehen Gegner der Impfpflicht seit einigen Wochen an Samstagen auf die Straße.
Zuvor hatte es nach Polizeiangaben in Reutlingen bereits eine Kundgebung der AfD gegen die allgemeine Impfpflicht unter dem Motto "Gesund ohne Zwang" mit bis zu 200 Menschen gegeben. An einer Gegenkundgebung nahmen bis zu 400 Demonstranten teil. Nach einer friedlichen Veranstaltung hätten Einzelne bei einem anschließenden Protestzug versucht, eine Absperrung zu durchbrechen. Das sei verhindert worden, hieß es bei der Polizei. Ein Demonstrant habe mit einer Fahnenstange auf einen Beamten eingeschlagen. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden, sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Vereinzelt sei es auch zu Gerangel zwischen Teilnehmern der AfD-Kundgebung und linken Gegendemonstranten gekommen.
Außerdem gab es am Samstagnachmittag einen Autokorso von Ludwigsburg über Stuttgart nach Reutlingen mit 117 Fahrzeugen, wie ein Polizeisprecher in Ludwigsburg mitteilte. Er sei insgesamt friedlich verlaufen.
In Freiburg gingen rund 2000 Menschen auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Die Demo sei nahezu störungsfrei gewesen. Es gab acht Platzverweise und drei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.
In Karlsruhe hingegen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers immer wieder Verstöße gegen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dort wurden bis zu 1300 Teilnehmer gezählt.

Update, 6. März, 7 Uhr: Corona-Inzidenz steigt weiter
Die Zahl der seit Pandemiebeginn bestätigten Corona-Infektionen hat sich in den vergangenen zwei Monaten mehr als verdoppelt. Wurden Mitte Januar noch rund 1,113 Millionen Ansteckungen in Baden-Württemberg gemeldet, so lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamts am Samstag bereits bei 2.249.638 Millionen registrierten Fällen (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der täglichen bestätigten neuen Infektionen hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt, wie aus dem Lagebericht des LGA hervorgeht. Sie liegt derzeit bei 21.896, Mitte Januar waren es noch rund 10.000.
Zugelegt hat auch erneut die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Sie stieg im Vergleich zum Freitag um 52,3 Fälle binnen einer Woche je 100.000 Einwohner auf 1450,8. Es ist bereits der vierte Anstieg in Folge. Laut LGA starben weitere 14 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt liegt die Zahl der Corona-Toten im Südwesten damit bei 14.423.
Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Samstag 245 Covid-Patientinnen und -Patienten behandelt, das sind neun weniger als am Samstag vor einer Woche. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht zu. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz schwankt weiter und ging nach einem leichten Anstieg am Vortag nun wieder zurück um 0,1 auf 7,2. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kommen.
Experten gehen allerdings von einer hohen Zahl an Ansteckungen aus, die in den Daten der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern. Oft werden Kontakte deshalb nur noch eingeschränkt nachverfolgt.
Außerdem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus. Befürchtet wird zudem, dass die Ausbreitung der neuen Variante BA.2 die Omikron-Welle verlängern und den Rückgang der Fallzahlen verlangsamen könnte.

Update, 5. März, 7 Uhr: Geschäft der Spielbanken leidet unter Folgen von Corona
Die drei baden-württembergischen Spielbanken haben 2021 infolge der Corona-Pandemie herbe Einbußen verzeichnet. Das Bruttospielergebnis betrug 46,8 Millionen Euro nach noch 67,99 Millionen Euro im Jahr 2020.
Die Spielstätten in Stuttgart, Konstanz und Baden-Baden seien von Oktober 2020 bis zum 15. Juni 2021 geschlossen gewesen, teilte Otto Wulferding, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Spielbanken mit.
In Folge der Schließung gingen die Besucherzahlen 2021 gegenüber 2020 um 27,5 Prozent zurück. Seit der Wiedereröffnung im vergangenen Sommer läuft der Betrieb nur eingeschränkt.
Die Tischspiele wie Roulette, Black Jack und Poker seien besonders von den Corona-Regeln betroffen. Pro Tisch sind nur vier Spieler zugelassen. Zwischen den Plätzen sind zum Schutz Acrylglas-Scheiben aufgestellt.

Update, 4. März, 18.10 Uhr: Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg nimmt wieder zu
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat wieder zugenommen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag (Stand: 16 Uhr) den dritten Tag in Folge, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. So nahm die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Freitag um 30,8 auf 1398,5 zu.
Die Behörde verzeichnete 30.222 Infektionen mehr als am Tag zuvor und 36 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle seit Pandemiebeginn auf 2.227.742, die Zahl der Todesfälle beträgt nun 14.409.
Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Freitag mit 241 Covid-Patientinnen und -Patienten sieben weniger behandelt als noch am Tag zuvor. Die Zahl der mit Corona infizierten Patienten auf den Normalstationen nahm laut den Meldedaten leicht zu. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg um 0,2 auf 7,3. Der Wert gibt an, wie viele Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kommen.
Der Umfang der tatsächlichen Infektionsfälle dürfte weiter deutlich größer sein. Die Gesundheitsämter verfolgen nicht mehr alle Infektionen und es besteht zudem ein erheblicher Meldeverzug. Zuletzt war weiter mehr als jeder zweite PCR-Test im Südwesten positiv. Je höher die Positivrate ist, desto größer fällt laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen aus.
Update, 4. März, 12.16 Uhr: 2020 deutlich weniger Jugendliche wegen Alkohols in Krankenhäusern
Deutlich weniger Jugendliche im Südwesten haben im ersten Corona-Jahr 2020 so viel Alkohol getrunken, dass sie im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Die Zahl der alkoholbedingten Behandlungen sank 2020 um mehr als ein Drittel, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. In den vergangenen 20 Jahren sei kein vergleichbarer Rückgang in dieser Größenordnung zu verzeichnen gewesen.
Rund 1500 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren kamen demnach im Jahr 2020 wegen einer alkoholbedingten Erkrankung stationär ins Krankenhaus. Dies seien 879 Behandlungen oder 37 Prozent weniger als im Jahr 2019 gewesen. Der Rückgang sei bei weiblichen und männlichen Jugendlichen ähnlich stark ausgefallen.
Eine Ursache für den deutlichen Rückgang könnte nach Einschätzung der Statistiker die Corona-Pandemie gewesen sein: Weil es weniger Partys gab und Clubs längere Zeit nicht offen hatten, hätten möglicherweise bei Jugendlichen die Anlässe gefehlt, Alkohol zu trinken.
Update, 4. März, 12.12 Uhr: FDP kritisiert Zinsen für Rückzahlung von Corona-Hilfen
Der FDP-Wirtschaftspolitiker Erik Schweickert (49) hat heftige Kritik an der Erhebung von Verzugszinsen für die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen geübt. Hier würden Unternehmen, die unverschuldet in Not geraten seien, auch noch staatlich abgezockt, sagte Schweickert am Freitag in Stuttgart. "Ich fordere die sofortige Aufhebung aller Zinsforderungen."
Baden-Württemberg unterstützte die Wirtschaft in der Corona-Krise auch mit eigenen Hilfsgeldern. Falls der Liquiditätsengpass aber geringer war als angenommen, müssen die Firmen Gelder zurückzahlen. Das Rückmeldeverfahren hatte Unmut bei Betroffenen ausgelöst.
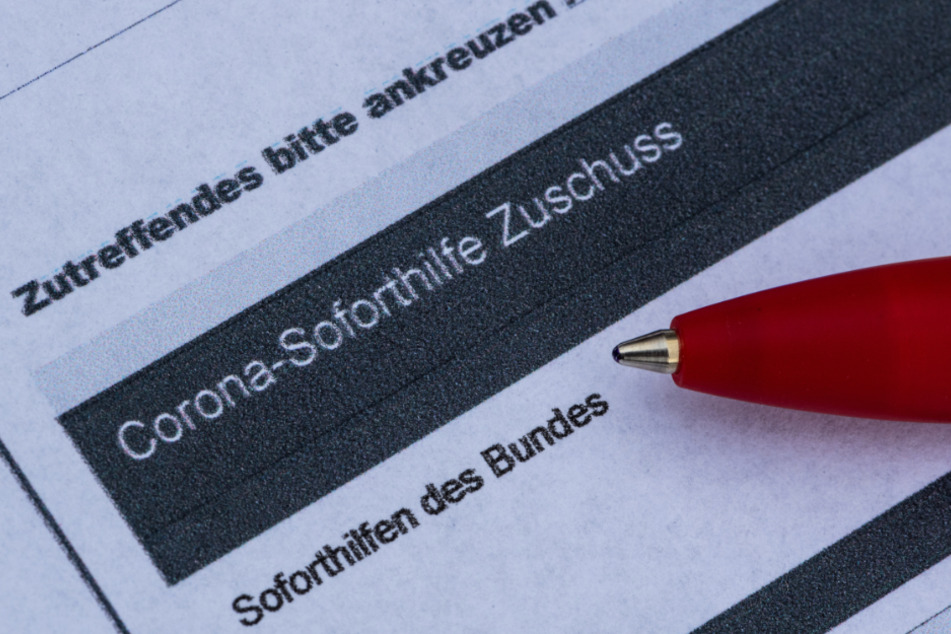
Update, 3. März, 19.24 Uhr: Weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg
Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser geht weiter zurück: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Donnerstag wurden noch 248 schwer erkrankte Menschen dort behandelt, das waren 6 weniger als am Vortag und 280 weniger als in der Vorwoche (Stand: 16 Uhr). Auf den Normalstationen ging die Zahl ebenfalls um 30 zurück auf 1560 Fälle (Vorwoche: 1672).
Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg stieg: Es wurden innerhalb einer Woche bei 1367,7 je 100.000 Einwohner Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Das waren 10,1 mehr als am Vortag. In der Vorwoche hatte der Wert bei 1451,8 gelegen.
Im Vergleich zum Vortag meldete die Behörde 31.013 neue Infektionen - ein Anstieg auf 2.197.520 registrierte Fälle seit Beginn der Pandemie. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile 14.373 Menschen gestorben. Das waren 39 mehr als am Vortag.
Update, 3. März, 9.31 Uhr: Weitere DEL-Spiele abgesagt - Schwenningen in Teamquarantäne
Villingen-Schwenningen (dpa) - Aufgrund einer Teamquarantäne der Schwenninger Wild Wings setzt sich die Reihe der Spielverlegungen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fort. Mehrere Teammitglieder seien mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Club am Donnerstag mit.
Das Gesundheitsamt habe eine Teamquarantäne für fünf Tage angeordnet. Die Spiele bei den Krefeld Pinguinen am Freitag und gegen die Düsseldorfer EG am Sonntag sind deswegen abgesetzt. Wann die Partien nachgeholt werden, steht nach Angaben des Clubs und der DEL noch nicht fest.

Update, 2. März, 18.01 Uhr: Zahl der Covid-Intensivpatienten sinkt
Für Mittwoch meldet das Landesgesundheitsamt 30.873 neue Corona-Infektionen. Damit haben sich inzwischen 2.166.507 Menschen angesteckt.
Es wurden 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger bekannt, die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 14.334.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 1357,6 (Vortag: 1355,1). Derzeit werden 254 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 17 weniger als am Dienstag.

Update, 2. März, 07.48 Uhr: Fast 1600 Corona-Patienten werden auf Normalstationen behandelt
Die Zahl der infizierten Corona-Patienten auf den Normalstationen der baden-württembergischen Krankenhäuser geht zwar leicht zurück, sie bewegt sich aber weiter auf hohem Niveau.
Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) wurden am Dienstag noch 1594 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung isoliert auf Normalstationen der Kliniken behandelt, das waren 18 weniger als am Vortag und 124 weniger als in der Woche zuvor. Weitere 271 infizierte Patienten sind schwerer erkrankt und liegen auf Intensivstationen (Vorwoche: 285).
Allerdings werden nach den Erfahrungen der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft etliche Infizierte gar nicht wegen Corona in einer Klinik aufgenommen, sondern weil sie sich verletzt haben oder an einer anderen Erkrankung leiden. "Nach den Berichten aus den Krankenhäusern steigt die Zahl derer, die mit und nicht wegen Corona im Krankenhaus sind, im Verhältnis an", heißt es auch bei der Krankenhausgesellschaft.
Dies liege unter anderem an der generell sehr hohen Zahl von Infizierten. Außerdem sind viele Menschen doppelt geimpft oder geboostert und somit besser geschützt gegen schwere Krankheitsverläufe, die oft auf den Intensivstationen enden.

Update, 1. März, 17.24 Uhr: Mehr als 28.100 neue Infektionen
Für Dienstag meldet das Landesgesundheitsamt 28.133 neue Corona-Infektionen. Damit haben sich inzwischen 2.135.634 Menschen angesteckt.
Es wurden 25 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Erreger bekannt, die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 14.303.
Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 1355,1. Derzeit werden 271 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, einer weniger als am Vortag.

Update, 1. März, 15.11 Uhr: Zwei Heidelberger Spiele nach Corona-Ausbruch abgesagt
Wegen eines Corona-Ausbruchs im Kader der MLP Academics Heidelberg sind zwei Spiele des Basketball-Bundesligisten abgesagt werden.
Wie der Aufsteiger am Dienstag bekanntgab, hat sich bei PCR-Tests am Montag herausgestellt, dass mindestens neun Spieler der Kurpfälzer mit dem Coronavirus infiziert sind.
Daher habe die Basketball-Bundesliga (BBL) dem Heidelberger Antrag auf Verlegung des Spiels am Donnerstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg sowie des für Sonntag geplanten Heimspiels gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt zugestimmt.
Die Nachholtermine stehen noch nicht fest. Die infizierten Spieler zeigten bisher keine oder nur milde Symptome, erklärte der Verein weiter.
Update, 1. März, 12.59 Uhr: Mehr Menschen gegen Corona-Politik als gegen Krieg auf den Straßen
In Baden-Württemberg sind am Montagabend deutlich mehr Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straßen gegangen als bei zeitgleichen Friedensdemonstrationen gezählt wurden. N
ach Angaben des Innenministeriums beteiligten sich rund 32.900 Menschen bei 284 Versammlungen unter anderem gegen die mögliche allgemeine Impfpflicht. In der vergangenen Woche seien es ungefähr genau so viele gewesen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag. Außerdem hätten sich einige weitere Kundgebungen, Aufzüge und nicht angemeldete Aktionen sowohl gegen die Corona-Politik als auch gegen den Krieg in der Ukraine gerichtet.
Die Polizei registrierte 80 Straftaten und 101 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, vor allem, weil gegen das Versammlungsgesetz und gegen die Corona-Verordnung verstoßen worden sei, wie es hieß.
Bei 13 reinen Friedensdemonstrationen kamen nach Angaben des Ministeriums rund 3700 Menschen zusammen. "Diese Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse", sagte der Sprecher.
Seit vielen Wochen protestieren vor allem Gegner der Corona-Maßnahmen regelmäßig. Dabei werden stets mehrere Zehntausend Menschen im ganzen Land gezählt.

Update, 1. März, 11.08 Uhr: Junghans will nach Corona-Delle wieder wachsen
Der Uhrenhersteller Junghans hat im vergangenen Jahr erneut die Auswirkungen der Coronakrise gespürt. Der Umsatz sank um etwa sechs Prozent auf knapp 18 Millionen Euro, wie das Traditionsunternehmen am Dienstag in Schramberg mitteilte.
"Der Lockdown in Deutschland war für uns ein herber Einschnitt", sagte Geschäftsführer Matthias Stotz der Deutschen Presse-Agentur. In den für das Unternehmen wichtigen Innenstadtlagen hätten Touristen und die Laufkundschaft gefehlt.
Insgesamt sei Junghans aber zufrieden und schließe mit einem leichten Gewinn ab, resümierte Stotz. Den Ertrag bezifferte er nicht. "Im laufenden Jahr wollen wir wieder über die Schwelle von 20 Millionen Euro Umsatz kommen." Die Signale aus dem Fachhandel seien ermutigend.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa
