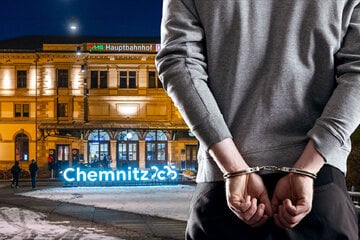19 "gefährliche Orte" in Chemnitz: So will die Polizei die Kriminalität eindämmen
Chemnitz - Vor vier Jahren gab es einen Aufschrei, als das sächsische Innenministerium nach einer kleinen Anfrage eine Liste mit 61 "gefährlichen Orten" veröffentlichte. Gefürchtet wurden "No-Go-Areas" in Sachsen. Doch was macht die Polizei hier? Und wie wirkt sich das auf die derzeit 19 "gefährlichen Orte" in Chemnitz aus?

"Durch die Einstufung besteht die Möglichkeit, unabhängig von einem gegen bestimmte Personen gerichteten Verdacht an Rückzugsorten der Kriminalität oder Orten, an denen zum Beispiel mit Drogen gehandelt wird, einschlägiges Klientel aus der Anonymität zu reißen", erklärt Kirstin Ilga (42), Polizeisprecherin des Innenministeriums.
Das heißt: Das sächsische Polizeivollzugsdienstgesetz (Paragraf 15, Absatz 1, Punkt 2) ermöglicht einfachere Personenkontrollen in Brennpunkten.
In Chemnitz befinden sich die meisten - neun von 19 - im Zentrum, gefolgt vom Sonnenberg mit fünf. Ilga: "Kriminalitätsschwerpunkte sind vorwiegend Diebstahlshandlungen, Körperverletzungsdelikte, Raubstraftaten und Betäubungsmitteldelikte."
Als "gefährliche Orte" zählen auch die Schlossteichinsel, zwei Asylbewerberunterkünfte, Bereiche im "Heckert" (Umfeld Paul-Bertz-Straße 14a und Dr.-Salvador-Allende-Straße 180) sowie der Konkordiapark.
Hier wurde am Donnerstagabend Kunstsammlungen-Chef Frédéric Bußmann (47) von jugendlichen Naziparolen-Schreiern zusammengeschlagen.

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar

Wegen Corona ging die Kriminalität sogar leicht zurück

Die Polizei vermeldet jedoch Erfolge, wie im Zentrum. "Es gibt hier konkrete Ergebnisse und gewollte Effekte der Zurückdrängung von Formen offener Drogenanbieterszenen wie im Stadthallenpark", schildert die Polizeisprecherin. Auch Raubdelikte wurden weniger. Problem: Die Kriminellen weichen aus.
"Dass auch Verdrängungseffekte eintreten, ist hinzunehmen. Kontrollen wirken dabei auch der Verfestigung von Szenen entgegen", so Ilga weiter. Neue "gefährliche Orte" musste die Polizei längerfristig nicht festlegen. Auch, weil wegen Corona die Kriminalität leicht zurückging.
Zur Wahrnehmung der "gefährlichen Orte" als "No-Go-Areas" hat die Innenministeriums-Polizeisprecherin eine klare Aussage: "Eine 'No-Go-Area' würde entstehen, wenn an kriminalitätsbelasteten Orten gerade nicht durch gesteigerte polizeiliche Kontrollen und andere Maßnahmen entgegengewirkt wird."



Ilga sieht auch Kommunen (wie durch Ordnungsämter) und Gewerbetreibende (zum Beispiel mit Ladendetektiven) in der Pflicht.
Titelfoto: Härtelpress/Uwe Meinhold